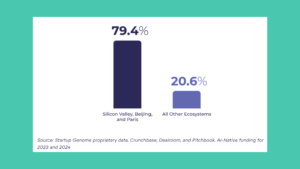AVCO-Chef Rudolf Kinsky: „Jedes Unternehmen braucht einen Techniker und einen Kaufmann, ansonsten fährt man an die Wand“

Er gehört zu einer anderen Generation an Investoren. Rudolf Kinsky erlebte in den 80er Jahren den Aufstieg der Wall Street, den Börsencrash in 1987 und die Finanzkrise. Aufgewachsen in Salzburg, arbeitete er insgesamt 30 Jahre in New York, London und Frankfurt. Seine Berufserfahrung spannt sich über Investmentbanking (First Boston, Charterhouse), Unternehmensberatung (McKinsey) und Private Equity (3i). Seit 2006 lebt er in Wien. Seine Spezialgebiete sind Wachstumsfinanzierungen für den Mittelstand und Venture Capital Investments.
Heute ist Kinsky Präsident und Geschäftsführer der AVCO (Austrian Private Equity and Venture Capital Organisation) und Senior Partner Österreich für DPE Deutsche Private Equity (München). Zusätzlich unterstützt er Apex Ventures als Mitglied des Advisory Boards und ist damit auch mit Startups und deren Finanzierung engstens vertraut.
Trending Topics: Weshalb zog es Sie nach Österreich zurück?
Rudolf Kinsky: 2006 bin ich nach Österreich, weil ich etwas Neues beginnen wollte. Meine Analyse war, dass Österreich und die CEE-Region für Private Equity salonfähig geworden sind. Es kam Kapital aus Amerika und UK in den Markt. Die Idee war gut, allerdings hat uns 2007 die Realität der Finanzkrise mitten im Fundraising eingeholt. Wir haben danach noch versucht, mit einem Cornerstone-Investor in Rumänien, Polen und Tschechien zu investieren. Es scheiterte an den hohen Bewertungen, worüber wir nachträglich auch froh waren. Die Immobilienpreise waren bedeutend höher als die letztendlichen Unternehmenswerte. Privat war mir wichtig, dass meine Kinder Deutsch lernen und wollte nach 30 Jahren im Ausland wieder mehr Zeit mit meinen Eltern und Freunden verbringen.
Welche Unterschiede haben Sie zu den USA festgestellt?
In Europa haben wir in Private Equity und Venture Capital einen partnerschaftlichen Ansatz und sehen uns mit der Aufstellung von Wachstumskapital gleichzeitig auch als Unternehmensentwickler. In den USA schmeissen große Fonds nach dem Gießkannen-Prinzip Millionen in den Markt und hoffen auf das Unicorn. Gleichzeitig haben die USA einen ausgebildeten und gut funktionierenden Kapitalmarkt, börslich wie vorbörslich, in dem unter normalen Umständen das Kapital rational verteilt wird. Es gab natürlich auch immer wieder Auswüchse und Krisen, die aber rasch ausgebügelt wurden.
Wie sehr hat die Finanzkrise das Private Equity-Geschäft verändert?
Wir hatten bei 3i bereits in 2000 Portfolio-Teams gebildet, für unsere Beteiligungen Strategien entwickelt, Controlling und Personalentscheidungen mitbestimmt. So wurden wir zu aktiven Partnern für die Unternehmen und nicht mehr die stillen Investoren im Hintergrund. Nichtsdestotrotz wurden wir durch die Krise zurückgeworfen. Die Branche hatte über vernünftige Maßen den Leverage-Hebel angesetzt. Das hat auch Geld verbrannt. Leider entwickelte sich das Märchen, dass wir aus dem Private Equity die Unternehmen filetierten und uns dann verabschiedeten. Mitnichten. Wir wollten im Grunde nichts anderes als die Eigentümer von Familienunternehmen, nämlich, dass die Unternehmen überleben und wachsen. Damals haben wir die Philosophie gelernt, die wir heute verkörpern, mit weniger Leverage zu kaufen und durch Wachstum und Unternehmensentwicklung unsere Rendite zu verdienen.

Wie hat sich die Geisteshaltung im VC-Bereich verändert?
Das beschriebene Credo der aktiven Unterstützung des Managements macht heute auch bei VC-Investments einen großen Unterschied. Ich sitze bei der Apex Ventures im Advisory Board. Dort haben wir gerade die ersten zwei Investments gemacht, weil wir glauben, dass wir wichtige Beiträge leisten können. Bei Haawk wollen wir einem US-Startup den Eintritt in den europäischen Markt erleichtern. Bei Kivu helfen wir bei der Entwicklung einer Markteintritts-Strategie.
Ist privates Kapital sinnvoller als jenes von Banken oder Förderungen?
Je nach Entwicklungsstufe eines Unternehmens haben Banken und Förderungen auch ihre Rolle. Nur haben VC/PE zusätzlich eine wichtige volkswirtschaftliche Bedeutung als Unternehmensentwickler. Sie erreichen höhere Wachstumsraten und schaffen mehr Arbeitsplätze als der Durchschnitt der Industrie, nur das wird leider nicht verstanden. Wir haben bei 3i eine Studie bei McKinsey in Auftrag gegeben. Das Ergebnis besagt, dass wenn der Lead-Partner im ersten Jahr die Hälfte der Zeit bei einem Unternehmen verbracht hatte, dann hat sich der Erfolg maximiert.
Wenn wir mit unserer Erfahrung und Knowhow nahe dran sind, entstehen zusätzliche Werte. Private Equity investiert Kapital vorrangig direkt in die Firma. So entsteht mehr reales Wachstum, weil die Mittel für Marketing und Strukturaufbau eingesetzt werden können. Wenn ein Unternehmen aber fremdkapitalfinanziert ist, dann müssen die Firmen jeden Euro umdrehen, um den Kredit zu bedienen. Dabei heißt es immer: Eigenkapital ist so teuer. Aber das ist ein Schmarrn. Das Geld arbeitet ohne Dividendenausschüttung im Unternehmen und sorgt für eine Rendite, wenn es zu einem Exit kommt. Während seines Einsatzes kostet das Kapital dem Unternehmen also nichts.
Wie funktioniert Ihr Private Equity-Geschäftsmodell?
Dazu ein Beispiel: Bei der DPE waren wir an einem deutschen Unternehmen beteiligt, das als Dienstleister die Wartung von großen Gebäuden im Bereich Elektrik und Elektronik betreibt. Dort gab es einen Generationenwechsel und gleichzeitig wurden 80 Prozent der Anteile an DPE verkauft. Das Unternehmen hatte vor 6 Jahren 50 Millionen Euro Umsatz. Wir haben mit 30 Akquisitionen den Umsatz auf 350 Millionen Euro erhöht. Was hätte die Unternehmerfamilie mit 100 Prozent der Anteile nur durch organisches Wachstum verdient? Deutlich weniger als den Wert, den sie jetzt beim Exit mit 20 Prozent erzielt haben. Es geht nicht nur um den Anteil, den man hat. Natürlich haben viele Unternehmer die verständliche Einstellung, dass sie nichts hergeben wollen, sich nicht in die Karten schauen lassen und sich das fehlende Kapital von der Bank holen. Doch die Banken können da nicht mehr mitspielen. Wir hingegen versuchen als Finanzpartner immer eine Wertsteigerung für das Unternehmen und seine Aktionäre zu erreichen.
Kommen wir zur Startup-Branche in Österreich. Wie sehen Sie diese?
Sie entwickelt sich gut. Nur Erfolg heißt auch nach fünf Jahren noch im Markt zu sein. Da zeichnet sich ein großes Umdenken ab. Junge Unternehmen müssen eine Strategie entwickeln, die sie stringent verfolgen. Venture Fonds sind für die Gründerszene die Dienstleister der Zukunft. Man muss Unternehmensentwicklung und Finanzierung voneinander trennen und möglichst früh an die nächste Runde denken, nicht erst wenn das Geld ausgegangen ist. Die Finanzierungsseite darf nie unterschätzt werden. Es muss dringend jemand in das Unternehmen, der mit Zahlen umgehen kann. Jedes Unternehmen braucht einen Techniker und einen Kaufmann, ansonsten fährt man an die Wand. Nur Produkt, Produkt, Produkt hilft langfristig nichts. Klein, klein und nur lokal bringt auch nicht viel. Man muss schnell seine Nische auf dem Weltmarkt finden.
Wachstumsfinanzierungen sind in Österreich schwer zu bekommen. Wie schließt man den Gap?
Genau wie wir in Österreich eine Börse für den Kapitalmarkt haben, die wie Dornröschen vor sich hinschlummert, brauchen wir am Standort auch eine institutionelle Ausgestaltung für Wachstumskapital über alle Phasen der Unternehmensentwicklung. Das wären lokal operierende VC und PE Fonds. Wenn das Geld aus dem Ausland kommt, dann werden Unternehmen von dort kontrolliert und wandern langfristig ab. Zuerst finanziert der Staat mit Förderungen die ersten Jahre, dann übernehmen ausländische Investoren. Das ist volkswirtschaftlicher Irrsinn. Wir müssen für die Entwicklung unseres Biotops, das viel zu wenig Kapital hat, schleunigst Ideen generieren. Wenn 20 Millionen jährlich aus der Angel-Szene kommen, dann ist das viel. Das ist aber lange nicht genug. Wenn ein Unternehmen von 10 auf 30 Menschen anwächst, dann reichen 5 Millionen kaum aus. Da braucht die Politik neue Eingebungen, um neue Fonds anzusiedeln bzw. entstehen zu lassen. Sonst wandern Unternehmen und Arbeitsplätze ab.
Welche politischen Incentives schlagen Sie vor?
Wir müssen z.B. Fonds von London nach Österreich bringen. Warum nicht? Wir brauchen neben Deutsch auch Englisch als Amtssprache. Deutsch ist eine Minderheitensprache. Die Welt funktioniert auf Englisch. Der Staat muss hier die Grundlagen schaffen. Wir haben die Lebensqualität, wir brauchen aber steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen. Wir haben bei der KeSt. und der USt. keine Rechtssicherheit in Österreich. Der Carried Interest ist nicht klar geregelt. So kommt kein ausländischer Fonds ins Land. Der Politik ist nicht einmal klar, wie diese Fonds funktionieren.
Auch die Abschreibung von Verlusten ist nicht möglich. Das sind einfache Vehikel, um uns als Standort attraktiver zu machen. Das Finanzamt will nicht, dass sich Fonds in Österreich als KGs etablieren. Das MiFiGG ist als sogenanntes Private-Equity-Gesetz ist damit leider eine Totgeburt. Investoren wollen endbesteuert werden, über eine Personengesellschaft, nicht über eine AG oder GmbH. Zusätzlich muss sich die FMA mehr zu einem Dienstleister entwickeln, das AIFMG novelliert werden und die aws die Rolle eines Ankerinvestors in Fondsgründungen übernehmen. Leider gibt es noch viele Baustellen.
Die Bürokratie ärgert viele seit langem.
Das öffentliche System der Behörden und Kammern ist in Österreich auf Verhinderung und Abschottung aufgebaut. Nur keinen Wettbewerb zulassen und das System und die damit zusammenhängenden Posten erhalten. Dieses Besitzstandsdenken muss gebrochen werden. Das inkludiert, dass es leichter gemacht werden muss, dass Leute aus dem Ausland nach Österreich zurückkommen bzw. sich hier ansiedeln. Eine Ansiedelung ist leider ein einziger Spießrutenlauf. WKO, Gewerbeschein, GmbH-Gründung, all dieser bürokratische Mehraufwand. Ich kenne europäische Ausländer, die in Wien ein Geschäft gründen wollten. Es war zu kompliziert. Sie gingen nach London.
An welchen internationalen Vorbildern könnte man sich orientieren?
Natürlich muss man sich in vergleichbaren Ländern die strukturellen und rechtlichen Einrichtungen im Kapitalmarkt ansehen. Wir stehen als Land auch im Wettbewerb mit denen. Wenn die aws ihre Aufgabe darin sieht, dass sich Fonds hier etablieren sollen, dann muss sie sich darauf und nur darauf konzentrieren. Der aws-Gründerfonds und der Mittelstandsfonds sind dadurch begrenzt, dass sie in Österreich investieren müssen. Gäbe es aber einen aws-Dachfonds, dann könnte man daraus Fonds-Neugründungen mit einem Ankerinvestment bei der Gründung unterstützen. Die Deutschen machen das in der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau, Anm.). Die KfW hat gerade einen 400-Millionen-Dachfonds aufgelegt. Warum machen wir das nicht auch? Es muss hier ein Finanzplatz entstehen. Speedinvest und APEX sind die Blaupause. Diese Fonds investieren 20 oder 30 Prozent in Österreich, weil sie lokal etabliert sind. Aber sie denken vertikal und nicht regional, sondern schauen nach Estland und Schweden, genauso wie in die USA oder nach Asien und suchen nach den besten Startups, wo immer sie sitzen.

Wie bewerten Sie die Rolle institutioneller Investoren?
Beim Fundraising der APEX sprechen wir mit deutschen Institutionen, aber in Österreich mussten wir bei den institutionellen Investoren (mit Ausnahme der AWS) die Segel streichen. Wenn eine Pensionskasse sich des VC/PE Themas annimmt, dann investiert sie in einen internationalen Dachfonds und nicht in eine APEX. Wir bräuchten lokale Institutionen, die 3 oder 4 Prozent in Private Equity investieren. Lebensversicherungen und Pensionskassen sind langfristige Investoren, die sollten sich zur Beimischung auch mit illiquiden Assets wie VC/PE Fonds auseinandersetzen und ins Risiko gehen.
Allerdings gibt es eine Reihe von regulatorischen Restriktionen, wie gesetzliche Veranlagungsrichtlinien und Kapitalhinterlegungspflichten, bei den Versicherungen Solvency II und den Banken Basel III. Dann haben die österreichischen Institutionen oft nicht die notwendigen Experten, um in diese Asset-Klasse investieren zu können. Zusätzlich bräuchten wir ein Drei-Säulen-Modell im Pensionssystem. Ein etabliertes privates Versicherungskonzept könnte zu einer höheren Zuwendung zu alternativen Investmentformen führen. Wie gesagt, es würde enorm helfen, wenn die AWS über einen Dachfonds als Ankerinvestor und Geburtshelfer für neue Fonds fungieren könnte.
Was ist mit den Stiftungen?
In Österreich lagern Werte von 70 bis 100 Milliarden in Stiftungen. Es kommt auf die Situation der Stiftungen an. Aber im Endeffekt könnten der Stifter aber auch die Begünstigten bestimmen, dass selektiv in VC/PE investiert wird. Da braucht es aber eine geduldige Aufklärungskampagne über diese Assetklasse. Es sollte in den Investmententscheidungen nicht nur um den Kapitalerhalt, sondern um Wachstum gehen. Aus unserer Sicht sollte man in Fonds investieren – da ergibt sich ein risikominimierender Streueffekt – und nicht nur in einzelne Startups.
Sehen Sie sich durch die zu erwartende neue Regierung besser vertreten?
Die verhandelnden Parteien denken beide marktwirtschaftlich. Das macht ein bisschen Hoffnung. Allerdings gibt es in Österreich die Tradition, dass der Papa oder eben der Staat es eh schon irgendwie richten wird. Diese Einstellung hat in diesen bewegten Zeiten keine Chance mehr. Wer sich den großen Umwälzungen, die die Digitalisierung bringt, passiv nähert, wird sang- und klanglos degradiert. Wir denken, dass immer jemand anderer unsere Probleme löst. Da sind Strukturen am Werk, die für einen unglaublich kleinen Output Unmengen an Personalkraft und Zeit vergeuden.
Wir haben die letzten zehn Jahre geschlafen. Wir standen in den Rankings mal ganz oben. Und wir können uns nicht auf die Finanzkrise herausreden, auf Griechenland oder EU. Die Regierungsparteien haben sich aus falschen Motiven heraus gegenseitig blockiert. Ich habe große Hoffnung, dass das nun besser wird. Auch dass mit einer Zweidrittelmehrheit mit den NEOS einiges möglich wird. Allerdings haben wir nach wie vor keine Politiker, die sich wirklich mit der Funktion des Kapitalmarkts auskennen. Ich hoffe, dass wir auch einmal gehört werden.