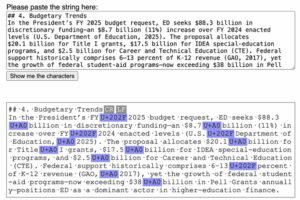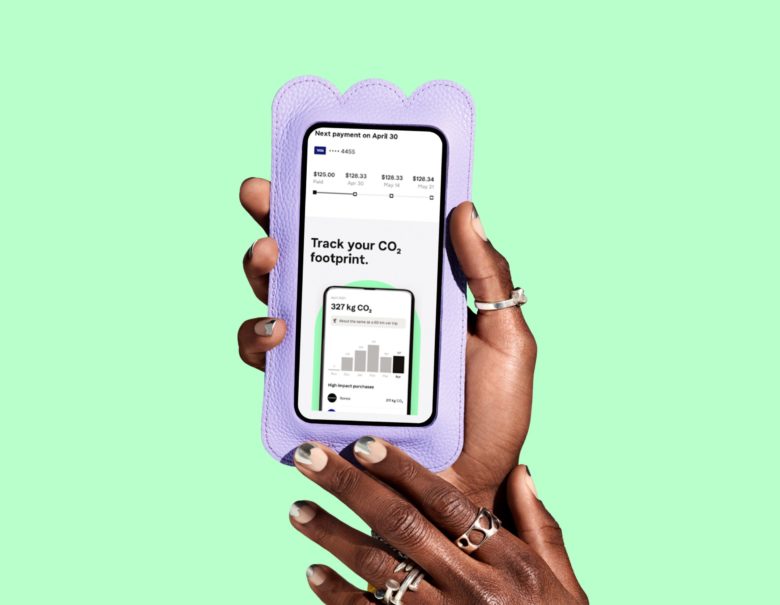Batterien: Forscher filtern erfolgreich Lithium aus dem Roten Meer

Lithium ist eine der Ressourcen der Zukunft. Insbesondere durch die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und den damit verbundenen Lithium-Ionen-Batterien braucht es immer mehr. Der Abbau ist dabei bisher aber zumeist wenig nachhaltig. Weltweit befinden sich die meisten Vorkommen des Rohstoffes zwischen Bolivien, Argentinien und Chile, wo er durch Verdunstung aus stark mineralhaltigen Grundwasser, wie Salzlaken, gewonnen wird. Informationen von der Umweltschutzorganisation Global 2000 zufolge, führt die stark wachsende Nachfrage nach Lithium allerdings zu sinkenden Grundwasserspiegeln und damit einher gehenden Wassermangel, einer höheren Luftverschmutzung und Staubwolken, welche Gesundheitsprobleme verursachen können.
Daher wird an verschiedenen anderen Möglichkeiten gearbeitet, Lithium zu gewinnen. Ein Forschungsteam der saudi-arabischen King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) hat dabei das Meer im Blick. Das macht auch Sinn. So befindet sich in den Ozeanen der Erde etwa 5000 Mal so viel Lithium wie an Land. Die tatsächliche Gewinnung ist dabei aber schwierig. So ist die Konzentration des Stoffes mit 0,2 ppm (parts per million) sehr gering. Eine Lösung für dieses Problem wollen die Forscher nun mithilfe eines Keramik-Membrams, Strom und Katalysatoren gefunden haben.
2021 bringt Millionen Euro für Öffis, E-Mobility und Radverkehr
Hochreines Lithium aus dem Roten Meer
Diese drei Bestandteile werden gemeinsam in einer elektrochemischen Zelle vereint. Der von den Forschern entwickelte Keramikmembran aus Lithium-Lanthan-Titan-Oxid (LiLaTiO4), enthält den Angaben zufolge Löcher, welche gerade groß genug sind um Lithium-Ionen durchzulassen, andere ebenfalls im Meer vorkommenden Metall-Ionen, wie Natrium oder Magnesium, aber nicht. Wenn diese elektrochemische Zelle zu Wasser gelassen wird, fließt das Wasser zunächst in eine zentrale Zuführungskammer, so die Forscher in einer Aussendung dazu. Anschließend gelangen positive Lithium-Ionen durch den LiLaTiO4 -Membran in eine Seitenkammer, bestehend aus Phosphorsäure und eine mit Platin und Ruthenium beschichtete Kupferelektrode. Die negativen Ionen fließen hingegen in eine dritte Kammer, in welche sich eine Natriumchloridlösung und eine Platin-Ruthenium-Elektrode befindet.
So soll es möglich sein, hochreines Lithium aus dem Meer zu gewinnen. Getestet haben die saudischen Forscher das Verfahren auch schon in der Praxis. Dafür nutzten sie Wasser aus dem Roten Meer. Mit einer Spannung von 3,25 Volt wurden die Lithium-Ionen durch den Membran getrieben. Diese reicherten sich dann in einer Seitenkammer an, zunächst noch mit Wasser angereichert. Nach vier weiteren Aufbereitungszyklen konnten die Forscher ihren eigenen Angaben nach in diesem Pilottest eine Lithium-Konzentration von 9.000 ppm erreichen. Trotz Spuren von anderen Metallionen soll es dann bereits so rein sein, dass es sich für die Herstellung von Batterien eignet.
Schweizer Forscher entwickeln biologisch abbaubare Mini-Batterie
Wirtschaftlich rentabel
Nicht nur aus wissenschaftlicher Perspektive, sondern auch aus wirtschaftlicher Perspektive sei der Prozess dabei lohnend, so das KAUST-Team. So gehen sie davon aus, dass pro einem Kilogramm Lithium etwa Strom im Wert von fünf Dollar benötigt wird. Diese Summe soll aber durch andere Nebenerzeugnisse der Zelle kompensiert werden können. So entstehen als Nebenprodukte Wasserstoff und Chlor, welche ebenfalls genutzt werden können. Außerdem könne man das restliche Meereswasser dann auch in Entsalzungsanlagen für die Süßwassergewinnung weiterverwenden, argumentieren die Forscher.
Für den großflächigen Einsatz ist diese Methode der Lithiumgewinnung aber im Moment noch nicht bereit. „Wir werden die Membranstruktur und das Zelldesign weiter optimieren, um die Prozesseffizienz zu verbessern“, so der Gruppenleiter Zhiping Lai dazu. Um den Membran zukünftig möglichst kostengünstig in großem Maßstab produzieren zu können, hoffen sie außerdem auf eine Zusammenarbeit mit der Glasindustrie. Veröffentlicht haben die Forscher ihre aktuellen Ergebnisse im Online-Journal Royal Society of Chemistry.