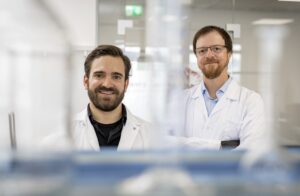FlexCo: Das sind die größten Kritikpunkte am geplanten Startup-Paket

Grundsätzlich gut und wertvoll – aber dann kommen ziemlich viele Abers. Nachdem die Regierung ihren Vorschlag für die Neugestaltung der Mitarbeiter:innenbeteiligung und die Einrichtung einer neuen Gesellschaftsrechtsform namens FlexCo/FlexKap neben GmbH und AG vorgestellt hat, gab es bis vor kurzem die Möglichkeit für alle betroffenen Branchen bzw. Interessierten, eine Stellungnahme für das „Start-Up-Förderungsgesetz“ abzugeben. 45 sind eingelangt und zeichnen ein gutes Bild, wie VCs, Startup-Gründer:innen und Ökosystem-Player dazu stehen.
Trending Topics hat sich durch die Stellungnahmen gewühlt und gibt einen Überblick über die am öftesten kritisierten Punkte.
1. Weiter Streit um den Notariatsakt
Kenner:innen der Materie wissen: Bei der FlexKap wollen die Notar:innen weiter mit am Tisch sitzen, sie beharren auf der so genannten „Formpflicht“. Die bedeutet: Notariatsakte sind bei der Errichtung und Änderung der GmbH-Gesellschaftsverträge (also im Wesentlichen die Gründung und dann später der Übertragung von Shares an Investor:innen und Mitarbeiter:innen) bei der GmbH verpflichtend, sollen es aber bei der FlexCo/FlexKap nicht mehr sein. Das Start-Up-Förderungsgesetz will nun Folgendes:
„Vereinfachte Übertragung von UW-A: keine Notariatsaktspflicht, sondern Schriftform ausreichend (auch mittels elektronischer Signatur möglich). Das betrifft auch die Erleichterung der Formvorschriften bei Anteilsübertragungen und Übernahmeerklärungen: Vorgesehen ist, dass die Anteilsübertragung auch in der Form abgeschlossen werden kann, dass ein:e Notar:in oder ein:e Rechtsanwältin eine Urkunde darüber errichtet. Im Vergleich zur GmbH braucht es daher nicht zwingend einen Notariatsakt.“
Das hat nun mittlerweile die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter (und vor allem deren Fachgruppe Firmenbuch) auf den Plan gerufen. Und die meinen: Eine einfache Urkunde wird nicht reichen, „das Firmenbuchgericht [wird] auch jede Anmeldung eines Gesellschafterwechsels nach dem FlexKapGG formell und materiell zu prüfen haben“. Es sei „Rechtsunsicherheit bezüglich der Wirksamkeit von im Firmenbuchgericht eingetragenen Gesellschafterwechseln“, die „Beibehaltung der Notariatsaktspflicht würde diese Gefahrenlage obsolet machen“.
Das sehen viele anders. „Was die Vereinigung als nicht Wirtschaftstreibende verkennt ist, dass sich diese strengen Formvorschriften schon lange nicht mehr bewähren und wesentlich zum inzwischen auch vom Schweizer IMD-Institut aufgezeigten Wegbrechen der österreichischen Standortattraktivität beiträgt“, so Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des Senat der Wirtschaft. Wie berichtet, hat der Senat bereits Kritik an dem Startup-Paket geäußert und es als „absolutes Minimum“ bezeichnet.
Hingegen heißt es etwa seitens des Wiener Scale-ups Tourradar in einer Stellungnahme. „Wir begrüßen die geplante Abschaffung der Notariatsakte für die Übertragung von Unternehmenswert-Anteilen.“ Bei Speedinvest ist sogar aus der Praxis zu lesen. Bezüglich fehlendem Notariatsakt hätte es genau einen Streitfall gegeben, bei mehr als 100 Startups in Ländern.
„Speedinvests Fonds sind an insgesamt etwa 100 Start-ups aus “Common Law” Jurisdiktionen ohne notarielle Formvorschriften im Gesellschaftsrecht beteiligt, insbesondere mit Sitz im Vereinigten Königreich und den USA. Unserer Erfahrung nach ist die gesellschaftsrechtliche Rechtssicherheit in diesen Ländern genauso hoch wie in Österreich; lediglich die administrativen Hürden sind in Österreich vergleichsweise hoch. Der einzige Gesellschafterstreit in unserem Portfolio betraf eine deutsche GmbH und fußte unter anderem auf der Frage, ob das gegebene Wandeldarlehen mangels Notariatsakt nichtig sei.“
Dass das Gesetz notarielle Formpflichten beseitigen will, aber diese dann etwa durch anwaltschaftliche Schreiben ersetzen will, geht manchen nicht weit genug. „Die Formvorschriften bei Anteilsübertragung wurde im FlexKapGG zwar spürbar (und in dringend notwendiger Weise) erleichtert (in Bezug auf die Notwendigkeit des Notariatsaktes), allerdings in § 12 FlexKapGG durch eine neue Formpflicht „sui generis“ ersetzt. Ein gänzlicher Entfall der Formpflichten wäre eine „echte“ Entbürokratisierung“, heißt es in einer Stellungnahme seitens dem österreichischen VC Push Ventures sowie invest austria.
Auch die bekannte Anwaltskanzlei Herbst Kinsky fordert den Wegfall des Notariatsaktes bei Anteilsabtretungen und Übernahmeerklärungen. „Die Errichtung einer Urkunde durch einen Rechtsanwalt mit entsprechender Aufklärungs- und Belehrungspflicht erscheint aus unserer Sicht ausreichend, um die Rechtssicherheit zu wahren“, heißt es in einer Stellungnahme.
2. Obergrenzen für Mitarbeiter:innenbeteiligungen
Dass die Mitarbeiter:innenbeteiligung für maximal 100 Team-Mitglieder kommen soll und Firmen dabei maximal 40 Million Euro Umsatz machen dürfen, stößt ebenfalls auf Unverständnis. „Unser Startup beschäftigt über Tochtergesellschaften in anderen Ländern mehr als 100 MitarbeiterInnen und hat diese Grenze bereits seit einigen Jahren überschritten, auch die Umsatzgrenze ist problematisch. Nicht nur anfangs, sondern gerade auch in unserer jetzigen Unternehmensphase sieben Jahre nach der Gründung, entscheiden oft die Unternehmensanteile darüber, ob wir eine Fachkraft von einem führenden Mitbewerber abwerben können, oder nicht“, so Petra Dobrocka vom Wiener Logistik-Scale-up byrd. „Gerade diese Fachkräfte können wir nur gewinnen, wenn es dafür funktionierende Beteiligungs-Modelle gibt, die auch für fortgeschrittenere, erfolgreiche Startups anwendbar sind. Mitarbeiter vergleichen dabei Angebote auf internationaler Ebene und somit wären Firmen aus anderen Ländern mit attraktiveren Modellen (z.B. Deutschland) besser gestellt.“
„Dies ist schlicht eine katastrophale Grenze“, heißt es seitens MAD Ventures aus Tirol. „Jedes erfolgreiche Startup wäre dann in kurzer Zeit verpflichtet, die MA-Beteiligung zu stoppen, genau dann, wenn es für die betroffenen Mitarbeiter besonders attraktiv wird. Das erscheint insbesondere für Startups, die international konkurrieren müssen (also fast alle) für inakzeptabel.“ Besser wäre, diese Grenze auf 500 oder 1.000 zu erhöhen.
„Auch erfolgreiche Scale-ups brauchen eine attraktive Mitarbeiterbeteiligung, um im internationalen Wettbewerb um die klügsten Köpfe bestehen zu können. Das Fehlen einer solchen Möglichkeit kann dazu beitragen, dass Scale-ups in andere Länder abwandern. Bei meinem ersten Startup Zoovu / Smartassistant (€200M VC raised, 250+ Mitarbeiter) war die aktuell in der Praxis sehr stark eingeschränkte Möglichkeit zur Mitarbeiterbeteiligung (insbesondere auch für im Ausland beschäftigte Mitarbeiter) ein Grund warum das UN das HQ zuerst nach GB und später in die USA verlegt hat“, so Markus Linder vom Startup inoqo.
Auch im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft von Minister Kocher (ÖVP) sieht man die Obergrenzen kritisch: „Dies widerspricht dem inhärenten Wachstums-Charakter von Startups. Damit bleibt ihnen ein wesentliches Instrument vorenthalten, Mitarbeiter:innen attraktive Mitarbeiterbeteiligungen anzubieten. Das stellt einen klaren Standortnachteil in einer Unternehmensphase dar, in der – ins-besondere aufgrund einer hohen Wertschöpfung und vielen Arbeitsplätzen – die rechtlichen Rahmenbedingungen für schnell wachsende Unternehmen besonders attraktiv sein sollten, um einem potentiellen Wegzug des Unternehmens aus Österreich möglichst hintanzuhalten.“
3. Fristen für Mitarbeiter:innenbeteiligungen
Wie berichtet, sieht das neue Gesetz auch vor, dass Mitarbeiter:innen nur nach bestimmten Fristen beteiligt werden können: Das Dienstverhältnis muss zumindest drei Jahre gedauert haben, und die Mitarbeiter:innen müssen die Shares mindestens fünf Jahre behalten. Das hat bereits der Rat für Forschung und Technologieentwicklung (RFTE) kritisiert, und auch in den öffentlichen Stellungnahmen ist das Thema.
„Diese Fristen entsprechen absolut nicht der Startup-Realität und sind jedenfalls zu lange. International üblicher sind kürzere Fristen (maximal 2 Jahre Mindesthaltedauer & 1 Jahr Mindestanstellung), damit Branchen mit schnelleren Time-to-Exit und spätere hinzukommende Mitarbeiter:innen nicht benachteiligt werden. In der aktuellen Fassung wäre diese Möglichkeit zur Mitarbeiterbeteiligung in der Praxis keine valide Alternative zum aktuell praktizierten PSOP Konstrukt“, so Lindner von inoqo.
„Die Fristen von drei und fünf Jahren werden der Schnelllebigkeit einiger Wirtschaftszweige nicht gerecht. Zielführender wäre es, die Fristen auf 1 Jahr (statt 3) und 2 Jahre (statt 5) zu verkürzen. Bei Beibehaltung der bisherigen Fristen würden vor allem Branchen mit späteren Exit-Zeitpunkt unsachlich profitieren“, heißt es auch seitens des Social Entrepreneurship Network Austria (SENA).
Sogar seitens des Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft gibt es Kritik an diesen Fristen. „International üblich wären kürzere Fristen, damit Branchen mit schnellerem Time-to-Exit und spätere Mitarbeiter/innen nicht benachteiligt werden. […] Es wird darauf hingewiesen, dass eine Behaltefrist von fünf Jahren und eine Mindestbeschäftigungsdauer von drei Jahren Mitarbeiter/innen benachteiligt, wenn der Verkauf des Unternehmens durch die Gründer/innen („Exit“) vor diesen Fristen erfolgt.“
4. Besteuerung von MA-Anteilen
Einer der Knackpunkte. Vorgesehen ist aktuell, dass Besteuerung von MA-Anteilen erst dann erfolgt, wenn die Shares wieder verkauft werden, also etwa im Falle eines Exits, spätestens aber nach zehn Jahren. Dafür soll es einen verbesserten pauschalen Steuersatz geben: ¼ wird auf Lohnsteuer-Basis versteuert, die restlichen ¾ mittels Kapitalertragssteuer (27,5 %). Gut, aber zu kompliziert, heißt es seitens AustrianStartups: „Der pauschale Mischsteuersatz ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, ist aber auch unnötig kompliziert. Es wäre sachgerechter einheitlich den Steuersatz der KESt von 27,5 % anzuwenden.“
Bei Speedinvest geht man in diesem Punkt noch härter ins Gericht: „Die Besteuerung von 75 % des Verkaufserlöses mit einem Satz von 27,5 % und der übrigen 25 % mit dem progressiven Lohnsteuersatz sind im internationalen Vergleich nicht nur unüblich, sondern auch nicht wettbewerbsfähig“, heißt es in der Stellungnahme. „Der gesamte Verkaufserlös sollte mit 27,5 % besteuert werden, zumal andere Länder ebenso eine Besteuerung des vollen Betrags mit Kapitalertragssteuer ermöglichen, die noch dazu in vielen Ländern deutlich niedriger ist, als in Österreich (im europäischen Vorzeige-Start-up-Land Großbritannien liegt diese zB oft bei nur 10 %).“
5. Aufsichtsratspflicht für die FlexKap
Aufsichtsräte kennt man bisher nur von der AG oder von GmbHs mit mehr als 50 Gesellschaftern, aber auch die FlexKap/FlexCo sollen sie bekommen. Auch das kommt nicht gut an: „Völlig systemwidrig ist es, dass die FlexCo einer strengeren Aufsichtsratspflicht unterliegt, als die GmbH. Die Aufsichtsratspflicht der FlexCo sollte zumindest an dieselben Mindestgrößen geknüpft sein, wie in der GmbH; sinnvollerweise aber wohl eine „flexiblere“ Regelung treffen, indem die Pflicht zur Bestellung eines Aufsichtsrats erst bei Überschreiten von höheren Kennzahlen als in der GmbH entsteht“, heißt es seitens Speedinvest. Aufsichtsratsmitglieder würden üblicherweise eine signifikante Entlohnung erhalten, und dementsprechend zu Mehrkosten führen – nicht im Sinne von schlanken Jungunternehmen.
Wer sich noch tiefer in die Stellungnahmen hineingraben will, sie sind hier gesammelt zu finden. Nun wird spannend, welche Änderungen das Startup-Paket noch bekommt – oder auch nicht.