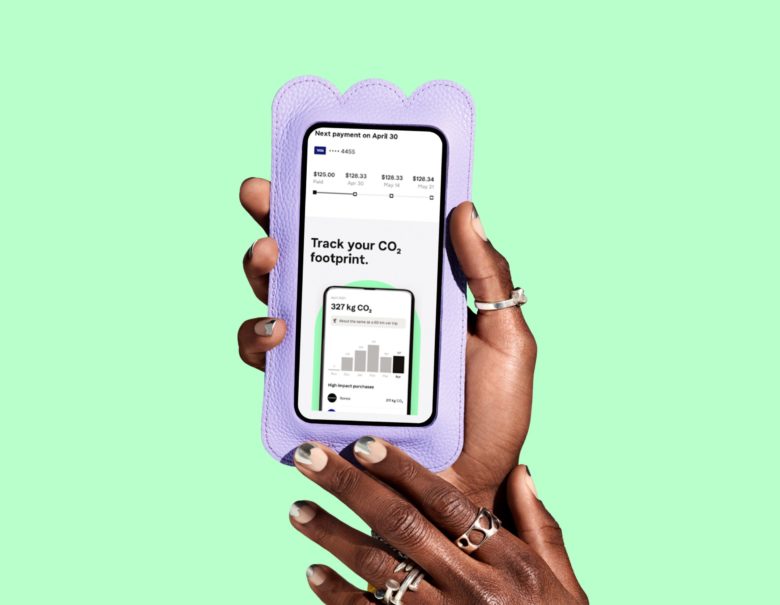Forschung : Verkehrswende geht ohne Umweltschutz – zumindest verbal

Die Verkehrswende ist eine häufig besprochene Notwendigkeit um die C02-Emissionen zu senken. Insbesondere ein Umstieg auf das Rad könnte im individuell Verkehr einiges bewirken. In punkto Radfreundlichkeit und Radwegenetz ist Kopenhagen ein Vorreiter. Während heute in vielen Städten immer noch über den Ausbau der Radwege disktutiert wird, sind in der dänischen Hautstadt die Menschen bereits vor mehr als 40 Jahren für ein besseres Radverkehrsnetz auf die Straßen gegangen. Eine Forscherin des deutschen Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS) hat nun untersucht, wodurch eine solche Akzeptanz für mehr Radfreundlichkeit in der Bevölkerung entstanden ist.
Für ihre wissenschaftliche Arbeit hat die IASS-Wissenschaftlerin Theresa Kallenbach in einer Narrativanalyse die fünf auflagenstärksten Tageszeitungen Dänemarks von 1977, 1980 und 1983 untersucht. Dabei kam sie auf vier Gründe, durch welche die Verkehrswende in der dänischen Hauptstadt begünstigt wurde.
Bikeparker: Salzburger Startup sorgt für platzsparende Fahrrad-Parkplätze
Verkehrssicherheit hat Priorität
Als den ersten Grund für die Forderungen der Menschen nach mehr Radwegen, nennt Kallenbach das Bedürfnis nach Sicherheit. So sei der dänische Diskurs damals stark von Unfallmeldungen und Nachrichten zur Verkehrssicherheit geprägt gewesen. Das führt sie auf die schlechte Sicherheitslage der Straßen in den 70-er Jahren zurück, aber auch auf die Affinität der Medien zu solchen Thematiken, die potenziell viel Aufmerksamkeit erreichen. Kallenbach: „Das Thema Verkehrssicherheit ist auch im aktuellen Diskurs erfolgsversprechend, es dient häufig als Grundlage für Forderungen nach einer vom Autoverkehr getrennten Radinfrastruktur.“
Umweltschutz muss nicht benannt werden
In Zusammenhang mit der Verkehrswende wird oft auch auf die Umweltfolgen verwiesen. Das sei den Ergebnissen der deutschen Wissenschaftlerin nach, aber nicht unbedingt förderlich. So verweist sie auf frühere Untersuchungen, welche gezeigt haben, dass sich Umwelt- und Klimaschutzthemen im öffentlichen Mobilitätsdiskurs schwerer durchsetzen. Von daher müssten die Forderungen für mehr Nachhaltigkeit an andere Ziele geknüpft werden, so Kallenbach auch mit Blick auf die Diskurse in Kopenhagen: „Die damals erkämpften Radwege bieten aber nicht nur Schutz vor Unfällen, sondern auch den Platz und Anreiz für die umwelt- und klimafreundliche Mobilität des Radfahrens. Es zeigt sich: Umweltschutz lässt sich auch erreichen, ohne über ihn zu sprechen.“
Beschuldigungen lenken von Mängeln ab
Das Phänomen ist wahrscheinlich den meisten bekannt: Als AutofahrerIn gilt die Wut den RadfahrerInnen. Ist das Rad das eigene Verkehrsmittel, wird auf die AutofahrerInnen geschimpft. Das hat Vor- und Nachteile im Diskurs für ein sicheres Radwegenetz, so die Wissenschaftlerin: „Ein Verschieben der Debatte von der gebauten Infrastruktur auf individuelles Verhalten ist ein Problem, weil es die Debatte entpolitisiert. Es scheint, als ginge es darum, dass sich die Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen nur ordentlich verhalten müssten. Das lenkt von Mängeln an der Infrastruktur ab, die oft ein Fehlverhalten begünstigen oder sogar erforderlich machen, wenn beispielsweise Radfahrende auf dem Gehweg fahren, weil sie sich auf einer engen Straße mit viel Verkehr zu unsicher fühlen.“
Stattdessen sollte dieses Fehlverhalten nicht einem Einzelnen zugeschrieben werden, sondern einer Gruppe, so Kallenbach. Ihre Analysen hätten gezeigt, dass fest zugeschriebene Eigenschaften hilfreich sein könnten: „Wenn die Radfahrenden ‚immer‘ die Zufußgehenden gefährden, dann brauchen sie offensichtlich einen eigenen Radweg. Wenn die Autofahrenden gar nicht anders können, als die Radfahrenden zu bedrängen, dann müssen sie baulich von den Radfahrenden getrennt werden.“ Die Unfallgefahr würde weiterhin durch die Bezeichnung „starker“ und „schwacher“ Verkehrsteilnehmende unterstrichen werden und würde den Wunsch nach einer baulichen Trennung der beiden Gruppen steigern.
Der Gegner des Rades ist nicht das Auto
Wie bereits im dritten Punkt beschrieben, verbindet die RadfahrerInnen und die AutofahrerInnen der gemeinsame Unmut. Im dänischen Zeitungsdiskurs vor Jahrzehnten war eine Gegnerschaft zwischen den beiden Parteien allerdings nicht das Thema, so die Deusche. Das Auto wurde mehr als unberechenbares, unbelebtes Objekt dargestellt, welche eine Gefahrenquelle sei, die durch die passende Infrastruktur in ihrem Risiko gemindert werden könnte. Als Gegner wurden eher Kommunen benannt, die keine Radwege bauen so Kallenbach. An diese wurden dementsprechende Forderungen gestellt, durch die sie in „die Rolle der Helfenden“ sich verwandeln konnten.
Diese vier Punkte hätten laut der Wissenschaftlerin im öffentlichen Diskurs dazu beigetragen, den Ruf nach mehr Radwegen und einer stärkeren Radfreundlichkeit ertönen zu lassen. Von daher sieht sie in diesen auch eine Change für eine Verkehrswende heutzutage.