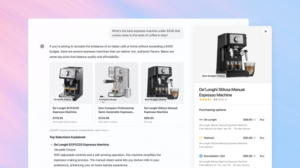Tom Standage von The Economist: „Personalisierte Werbung bedeutet, die Leute zu überwachen“

Tom Standage spielt gerade mit der neuen Apple Watch herum, als ihn HORIZONT in seinem winzigen Londoner Büro trifft. „Willkommen in meiner kleinen Kammer“, lacht der sechsfache Buchautor, der als stellvertretender Chefredakteur des Economist auch die Aufgabe hat, die Digitalstrategie des renommierten Wochentitels mit 1,55 Millionen Abonnenten weiterzuentwickeln.
Sie sind für die Digitalstrategie des Economist verantwortlich. Wie definieren Sie diese?
Tom Standage: Das Wichtige ist, dass unsere Strategie nicht vom Medium abhängt, auf dem wir publizieren. Wir denken nicht „Print First“ oder „Digital First“. Wir sind in einer besonderen Position, etwa 60 Prozent der Umsätze kommen von den Abonnenten, der Rest stammt unter anderem von den Events, nur ein kleiner Teil aus der Werbung. Wir werden von den Lesern bezahlt, weil wir ein vertrauenswürdiger News-Filter sind. Wir destillieren die News für die Leser. Das kann in einem wöchentlichen Magazin passieren, aber auch in vielen anderen Kanälen. Und Digital bietet uns die Chance, diesen Job auf verschiedene Art zu erledigen. Unsere Webseite etwa dient eher dazu, unseren Content Nicht-Abonnenten zu zeigen, unsere tägliche „Espresso“-App kostet etwas, weil sie eben den Filter-Job erledigt.
Trotzdem stößt man im Internet, etwa via Facebook oder Twitter, immer häufiger auf Inhalte des Economist, die man kostenlos nutzen kann.
Standage: Mein Job ist es, herauszufinden, welche der neuen Möglichkeiten Sinn für uns machen. Bei News ist die Sache relativ einfach: Wir verlangen eine monatliche Gebühr, wenn du die Apps nutzen willst. Bei Audio und Video verhält es sich anders, da gibt es keine große Tradition eines Abomodells. Video, Podcasts und Social Media sehen wir als Möglichkeit, um die Leute mit unserer Marke bekannt zu machen. Viele Menschen haben vielleicht schon vom Economist gehört, glauben aber womöglich, dass wir nur Wirtschaftsnachrichten machen. Ihnen können wir zeigen, dass wir viel mehr machen, in der Hoffnung, dass sie einmal Abonnenten werden. Das sind die zwei Säulen der Strategie: Es geht um Reichweite und es geht um die Stärkung der Abos.
Etwa 15 Prozent der Economist-Abonnenten sind bereits rein digital. Geht dieser Trend zulasten der Print-Abonnenten?
Standage: Das ist nicht der richtige Weg, sich die Sache anzusehen. Die meisten Verlage versuchen, ihre Leser von Print zu Digital zu überführen. Für die Financial Times als Tageszeitung etwa macht das Sinn, weil ja die Druckkosten ein sehr großer Posten sind. Wir tun das als Wochentitel aber nicht. Die Digital-only-Zahlen erzählen nicht die ganze Geschichte, weil wir Hunderttausende Abonnenten haben, die für das Kombi-Abo aus Print und Digital bezahlen. Der Trend zeigt, dass die Hälfte der neuen oder wiederkehrenden Abonnenten das Kombiangebot nimmt, ein Viertel nur Print, ein Viertel nur Digital. Jetzt kann man sagen: Drei Viertel sind Print-Abonnenten, oder drei Viertel sind Digital-Abonnenten. Die Annahme, dass Print und Digital Feinde sind, und einer gewinnt und der andere verliert, ist einfach falsch.
Die Digital-Abos wachsen stark, 2014 im Vergleich zu 2013 um 77 Prozent. Hält der Trend an, wird Print irgendwann verschwinden.
Standage: Unsere Mission ist nicht, zu 100 Prozent Digital-Abonennten zu kommen, unsere Mission ist es, den Kunden zu geben, was immer sie wollen. Wenn sie Print in zehn Jahren noch wollen, können sie Print kaufen. Weil unsere Abopreise sehr hoch sind, werden wir unser Printgeschäft wahrscheinlich länger als andere betreiben können. Wenn wir den Preis noch etwas erhöhen würden, würden wir sogar ohne Werbeeinnahmen auskommen. Und wir erreichen bald den Punkt, an dem wir ohne die Einnahmen aus Print überleben könnten.
Sie bewerten Werbung als nicht tragfähiges Geschäftsmodell für Onlinejournalismus – warum?
Standage: Auf Onlinewerbung als einzige oder größte Einnahmequelle darf man sich als Publisher nicht verlassen. Das ist ein gefährliches Modell. Onlinewerbung ist ein Riesengeschäft, aber das meiste Geld wandert zu Google und Facebook. Es gibt immer mehr Webseiten, das Inventar wächst permanent – und die Preise sinken. Zusätzlich drückt Mobile die Preise, und Programmatic Buying sorgt ebenfalls für eine Abwärtsspirale. Auch das Versprechen, mit personalisierter Werbung wieder mehr Geld zu verdienen, ist ein gefährliches. Denn personalisierte Werbung bedeutet, die Leute zu überwachen. Jedes Geschäftsmodell, das auf der Überwachung der Leser basiert, ist ein Problem. Insgesamt heißt das: Das Online-Werbegeschäft wird für Medienunternehmen immer schwerer und schwerer.
Vice oder BuzzFeed als digitale Gratismedien scheinen von Werbegeldern ganz gut zu leben.
Standage: Man könnte sagen, dass das Agenturen sind, die sich als News-Medien verkleiden. Das ist clever, weil sie sowohl redaktionellen als auch gesponserten Content produzieren und diese vermischen. Sie verwenden die News, um Publikum und Glaubwürdigkeit für die Marke aufzubauen, und diese Reichweite geben sie dann dem gesponserten Content. Ich glaube allerdings nicht, dass dieses Modell für alte Medienhäuser funktioniert, weil deren Marken auf dem jahrelangen Versprechen basieren, Redaktion und Werbung streng getrennt zu halten. Vice und BuzzFeed haben dieses Versprechen als junge Marken niemals gegeben. Wer heute mit einem neuen Medienprojekt startet, der muss dieses Modell verfolgen.
Es gibt diesen Riesentrend zu Content Marketing, Native Advertising und Branded Content. Halten Sie das für eine sinnvolle Art der Werbung?
Standage: Was passiert, ist Folgendes: Früher hatte eine kleine Gruppe von Unternehmen die Kontrolle über die Druckereien und Funkanlagen, und die Wirtschaft musste sich rund um den Content der Massenmedien ihren Platz erkaufen. Im Internet aber kann jeder einen direkten Draht zum Publikum aufbauen, jede Firma kann heute Publisher sein. Jedes Unternehmen braucht heute die Skills der Journalisten, wie man Storys erzählt. Sie können dies Skills selber aufbauen, oder sie kooperieren mit Medien, die ihnen diese Dienste anbieten. Eine eigene Abteilung des Economist, die getrennt von der Redaktion arbeitet, etwa hat für General Electric eine eigene Content-Seite aufgebaut. Aber es wie BuzzFeed zu machen und die Ads unter den eigenen Content zu mischen würde für uns nicht infrage kommen.
Solange transparent ist, wer wen wofür bezahlt, scheint das Modell vernünftig.
Standage: Exakt. Ich habe ein Problem damit, wenn Native Advertising irreführend ist. Und es gibt Studien, die zeigen, dass die Leute es schätzen, wenn sie genau wissen, wer den Werbeartikel bezahlt. Bei uns wird der Content für Unternehmen in New York produziert, das ist sogar geografisch von der Redaktion getrennt.
Sie sind redaktionell verantwortlich für die Tochter Economist Films. Warum der Einstieg ins Videogeschäft?
Standage: Video ist ein schweres Thema für uns, weil wir lange nicht wussten, wie wir unsere Werte in diesem Medium unterbringen können. Aber jetzt glauben wir, einen Weg gefunden zu haben. Unsere Videos werden sowohl auf unserer Webseite als auch auf YouTube, Facebook oder Twitter oder sogar Snapchat zu sehen sein, wer weiß. Wir wollen unsere Marke und ihre Werte zu einem neuen, jungen Publikum bringen. Der redaktionelle Content wird mit Sponsorings finanziert, die aber keinen Einfluss auf die Inhalte haben.
Der Video-Content wird also auf den Plattformen von großen Tech-Firmen stattfinden.
Standage: Mit Artikeln, die Geld kosten, würde das nicht funktionieren, aber Videos werden hauptsächlich auf diesen Plattformen angesehen. Die kostenlosen Videos sind also komplementär zum Abomodell zu verstehen.
Kann man Social-Media-Nutzer zu Abonnenten machen?
Standage: Ein Drittel unseres Traffics kommt über Social Media. Allerdings, und das gilt für die gesamte Branche, sind Social-Media-Nutzer weniger aktiv als Leute, die die Webseite direkt ansurfen. Die Zahl der Leute, die von Social Media kommen und dann Abonnenten werden, ist wenig verwunderlich kleiner als von anderen Quellen. Jemand, der sich auf der Webseite registriert, um kostenlose Artikel zu bekommen, wird viel eher zum Abonnenten.
Ein wichtiger Player im digitalen Mediengeschäft ist Google, das kürzlich in Partnerschaft mit europäischen Medienhäusern die “Digital News Initiative” (DNI) vorgestellt hat. Wie bewerten Sie das?
Standage: Es gibt Publisher, die glauben, dass Google böse ist. Das ist, als würde man mit einem T-Shirt herumlaufen, auf dem groß steht „Ich verstehe das Internet nicht!“ Google News ist brillant, es liefert kostenlosen Traffic, und ich verstehe nicht, wo da das Problem sein soll. Ein wichtiger Punkt auch für uns ist, dass Google kompatibler mit Online-Publishern werden soll, die Paywalls haben. Google hat das in den letzten Jahren schon öfter versucht, aber man muss einmal abwarten, wie das funktionieren wird.
Ihre Publikation selbst hat eine Nähe zu Google – Google-Vorstandsvorsitzender Eric Schmidt sitzt im Vorstand der Economist Group.
Standage: Wir haben ihn dazu eingeladen, weil er die digitale Welt versteht und weil wir mehr Wissen darüber brauchen. Wir bekommen deswegen aber keine Spezialbehandlung von Google. Launch-Partner waren alles Tageszeitungen, und wir sind eben keine Tageszeitung. Ich bin aber gespannt, wie sich die Sache für die Financial Times entwickelt, die ein ähnliches Abomodell und eine ähnliche Leserschaft wie wir haben.
Oft wird heute gesagt, dass Journalisten ihre eigene Marke werden müssen, mit ihrem eigenen Publikum auf Facebook und Twitter. Beim Economist gibt es keine Autoren. Wird sich das ändern müssen?
Standage: Ich glaube nicht, dass diese Anonymität der Autoren fallen wird. Der Vorteil für uns ist, dass es die Qualität verbessert. Ohne Verfasser sehen wir alle blöd aus, wenn ein Fehler publiziert wird. Wir haben eine kollektive Verantwortung für alle Artikel. Die Idee, dass Journalisten zur Marke werden sollen, ist älter als das Internet. Es gab immer schon Starjournalisten, die Bücher geschrieben haben und im TV aufgetreten sind. Im 19. Jahrhundert gab es keine Autorenzeilen, dass ist erst nach 1945 außer Kontrolle geraten. Zuerst haben jene eine bekommen, die richtig gute Berichte geschrieben haben, und dann wollte jeder eine. Dann sind Bilder dazugekommen, dann die Twitter-Namen. Aber unsere Anonymitätspolitik ist an den Rändern bereits aufgeweicht worden, vor allem durch Twitter. Und in der Praxis weiß man in den jeweiligen Branchen ohnehin, wer einen Artikel wahrscheinlich geschrieben hat. Wenn wir Leute von anderen Medien abwerben, müssen sie auf ihre Autorenzeile verzichten. Das ist aber ein nicht so großes Problem, weil sie ihre Twitter-Follower mitnehmen können und diese dann wissen lassen, welche Artikel sie geschrieben haben.
Der Economist ist Vorbild für viele Journalisten. Was aber sind Ihre eigenen Vorbilder, woran orientieren Sie sich?
Standage: Ich liebe den New Yorker, weil er so eine hohe, konsistente Qualität bietet. Er passt auch super zum Economist: Der Economist ist global, und der New Yorker ist in dieser tollen Stadt verwurzelt. Die Financial Times am Sonntag lese ich auch sehr gerne. All diese Titel erledigen einen tollen Job, und so sollte man auch denken: Nicht, wie man etwas verkaufen kann, sondern welche Aufgabe man für den Leser erfüllen kann.